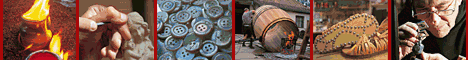Venedig ohne Berge
 |
| |||||||
diesen Falter bestellen | ||||||||
Wenn freundliche, bescheidene Menschen Erfolg haben, erfüllt einen das
mit dem Gefühl universaler Gerechtigkeit. Herbert Brandl, geboren 1959
in Graz, ist wohl der freundlichste Mensch der Welt. In einem Innenhof
im achten Wiener Bezirk liegt sein Atelier, eine lichtdurchflutete
Halle, ein Superspielplatz, eine Oase. Abstrakte Riesengemälde, die wie
Expeditionen ins Wesen der Farbe wirken und deren Preis jeweils
mindestens 66.000 Euro beträgt, lehnen an den hohen Wänden, sie werden
am selben Nachmittag abgeholt, nach Venedig gebracht. Die schönsten
Katzen der Welt, zwei amerikanische Maine Coons und ein Bengale,
streifen herum. Ein Modell des österreichischen Biennale-Pavillons
steht am Boden, daneben ein Tisch, ein Sessel, Designerstücke. Ein
Stuhl wird dazugerückt, und Brandl gelingt es im Nu, inmitten all der
riesigen Farbtafeln Kaffeehausatmosphäre zu erzeugen, einfach indem er
sich hinsetzt. Er spricht leise oder besser: fein. Alles an ihm, um ihn
– und das Format seiner Gemälde steht dazu in keinem Widerspruch – hat
etwas Feines: sein Gesicht, dem eine Autoimmunerkrankung gerade alle
Haare abspenstig macht („Tut nicht weh.“), sein Humor, sein Lachen.
Immer wieder lacht er, amüsiert und bescheiden, so fängt das Gespräch
an, Herbert Brandl soll seine Karriere in sieben Sätzen umreißen.
Herbert Brandl: Sieben auf einen Streich. Hm. Studiert habe ich in Wien
an der Hochschule für angewandte Kunst, aber ursprünglich nicht
Malerei. Ich habe dann auch den Lehrer gewechselt und bin zu Peter
Weibel (Medientheoretiker und u. a. Kurator der Grazer Neuen Galerie,
Anm.) gegangen, zu neuen Medien, Performance. Aber ich hatte immer
einen eigenartigen Hang zur Ölfarbe und habe beim Weibel in der Klasse
auch nur gemalt. Bis ich dann aufgehört habe, an die Schule zu gehen
(lacht). Das war damals eine günstige Zeit, Peter Pakesch (Grazer
Kunsthaus-Intendant, Anm.) hat gerade mit seiner Galerie begonnen. Und
ich habe eigentlich früh verkauft. Aber gut, das war in den Achtzigern,
es gab diesen Boom der jungen Maler, da konnte man vom Malen eigentlich
schon ganz gut leben.
Falter: Jetzt vertreten Sie Österreich bei der Biennale. Eine Überraschung?
Ich hatte das eigentlich vergessen oder abgeschrieben. Ich hatte den
Eindruck, die Biennale ist eher was für viel jüngere Leute (lacht), ich
bin schon ins Alter gekommen. Aber so ganz stimmt’s auch nicht. Und
Malerei hat man in einem österreichischen Pavillon eigentlich schon
lange keine mehr gesehen. Überhaupt ist derzeit nicht so viel Malerei
zu sehen, das meiste ist installativ, konzeptionell, Skulpturen. Ich
freue mich sehr darüber, weil es doch eine enorme Aufmerksamkeit
bringt, und zur gleichen Zeit finden ja noch die Kunstmesse Basel und
die documenta statt.
Sie waren 1992 bei der documenta 9 dabei. Das bedeutet, man ist etabliert, oder?
Naja, es weiß dann halt jeder. Aber dass man dadurch etabliert ist, das
glaube ich nicht. Es kann ein guter Aufwind sein. Mir brachte es damals
einige Folgeausstellungen und superinteressante Begegnungen und
Kontakte. Man lernt eine Menge Künstler kennen, Kuratoren, Kritiker.
Die kommen nicht zu Einzelausstellungen.
Vor kurzem sprach man ja noch von der Krise der Malerei. Haben Sie die gespürt?
Seit ich male, seit gut dreißig Jahren, wird die Malerei immer wieder
totgesagt. Trotzdem gab es immer wieder super Maler, die durchgehalten
haben, bis ins hohe Alter. Aber diese Zeit gab es schon. Ich glaube,
ich habe damals begonnen, Bergbilder zu malen. So mit dem Gedanken:
„Jetzt kannst ruhig diesen Scheiß malen, Malerei wird sowieso nicht
mehr ausgestellt.“
Diesen Scheiß?
Weil es als abwegiges Thema empfunden wurde. Da konnte man gleich
Blumen und Berge malen. Das war zu einer Zeit, als in Kunsträumen
wirklich fast nur mehr Videokojen zu sehen waren. Aber siehe da: Kurz
darauf boomte Malerei wieder.
Empfindet man das als unheimlich, dass diese Konjunktur scheinbar gesteuert werden kann?
Es wird schon auch gesteuert. Aber berechnen kann man es nicht, da ist immer noch ein großer Unsicherheitsfaktor dabei.
2005 waren Sie dann mit der „Neuen Abstrakten Malerei aus Österreich“ in China. Hat man Sie dort verstanden?
Nein, das glaube ich nicht. Die Chinesen sind, was den Blick auf den
Westen betrifft, natürlich stark auf Amerika fokussiert. Europäische
Kunst, kommt mir vor, ist für die so was wie Kunst aus dem Märchenland.
Natürlich abgesehen von Immendorf, der dort ein Heiliger ist, durch die
kommunistische Phase in seinen Bildern, der ist wirklich sauberühmt.
Ich habe nächstes Jahr wieder eine Ausstellung in Peking, über meine
Frankfurter Galerie, die lustigerweise gut an chinesische Sammler
verkauft. Ich hatte eher den Eindruck, die werden das sofort vergessen,
aber es gibt wohl doch ein Interesse ...
Vor zwei Jahren hat Hans Schabus den Biennale-Pavillon zum Berg gemacht. Und jetzt kommt der, der die Bergbilder malt.
Es wird aber kein Bergbild zu sehen sein (lacht). Das war von Schabus
ja sehr gezielt auf Österreich und den Pavillon hin gemacht. Das ist
ein Riesenstatement, das mit seinem anderen Werk gar nicht so verbunden
ist, oder? Aber natürlich habe ich mir gleich mal gesagt: Berge kannst
du da jetzt keine zeigen. Ich male jetzt auch schon längere Zeit keine
Berge. Nur ab und zu gönne ich mir noch eine kleine Bergtour.
Was haben Sie sich für Venedig vorgenommen?
Ich möchte alles einfach halten. Die Räume sind recht schlicht, es wird
nicht so radikal umgebaut, dass man sagt: Aha! Nur auf das Licht haben
wir Rücksicht genommen. Wie sich die Bilder dann zueinander auf diesen
Wänden verhalten, das muss ich vor Ort testen. Das ist auch das, was
mich noch interessiert. Bei der Arbeit davor habe ich einfach einen
malerischen Flow ausgenutzt, wie auf einer Welle dahinsurfen, solange
es geht. Und jetzt muss ich entscheiden, was ich da herausnehme.
Haben Sie Berater?
Ja, das ist auch ganz lustig. Man muss schon fast richtige
Meinungsumfragen abhalten, weil viel mehr Leute involviert sind als bei
einer normalen Ausstellung.
Bei der letzten Biennale war ein eindeutiger Überbietungscharakter zu
spüren. Es schien sehr darum zu gehen, Aufmerksamkeit zu erzwingen.
Das ist eben das Problem. Denn eigentlich will ich nur meine Malerei
entfalten und entwickeln und nicht etwas für einen Event machen. Das
passt nicht in mein Denken. Aber im Hinterkopf hat man’s, und das ist
problematisch. Es soll eine in sich klare Geschichte sein, die nicht
nur auf das Spektakel abzielt. Natürlich hätte ich noch größere Formate
machen können ... (lacht)
Ist Malerei Farbe auf Leinwand?
Gerade diese riesige Einschränkung ist zugleich das Spannende. Im
Rahmen von „erweiterter Malerei“ kommt man um die Malerei, um die
Peinlichkeit herum: Man stellt es in den Raum, in extremen Dimensionen,
geht an die Decke, an den Boden, bringt die Farbe anders an, und so
weiter. Aber dort wollte ich nie hin, ich wollte immer straight das
Format haben, ganz eng, ganz eingeschränkt.
Das Peinliche?
Man kriegt ja immer zu hören, das ist konservativ, lange überholt. Aber
es gibt in diesem Dispositiv nach wie vor viel zu tun. Nur mit Leinwand
und Pinsel. Aber mir ist es ja eh nicht peinlich. Vielleicht meinen
Händlern ... (lacht)
Man tut sich schwer, in Ihren Arbeiten eine lineare Entwicklung zu
sehen. Was mir aber auffällt: Ihre Bilder werden immer größer.
Das ist keine schlechte Beobachtung. Ich habe jetzt alles
zurückverfolgt, was ich im Laufe der letzten zwanzig Jahre gemacht
habe. Die Bilder wachsen anscheinend wirklich pro Jahr um zehn
Zentimeter. Und ich habe Lust, dass sie noch mehr Dimension kriegen.
Und die lineare Entwicklung war für mich immer ein wichtiger
theoretischer Punkt. Gerade von Peter Weibel kam das Diktat, alles
müsse sich linear, und zwar nach oben, entwickeln, die Wirtschaft und
die Kunst. Und man müsse alles weglassen, was schon gemacht worden ist.
In den letzten zehn, 15 Jahren scheint sich das aber verändert zu
haben. Das sieht man auch an der Arbeit, die ich bis jetzt gemacht
habe. Dass die Dinge immer wiederkehren, fast wie saisonal bedingt.
Ihr Vater hat Ihnen ja als Kind das Matterhorn als Zeichenvorlage
gegeben. War das eine lange Geschichte des Scheiterns an diesem Berg?
Da haben Sie recht, das ist eine lange Geschichte, die eigentlich damit
begonnen hat, dass mein Vater – er war Hobbymaler und Hobbyzeichner –
diese Zeichnung auf die Wand gemacht hat. Ich habe dann darauf das
Matterhorn mit einem Messer eingeritzt. In meiner Kindheit war das
Scheitern in der Malerei tagtäglich da, als ich realistisch zeichnen
wollte, aber nicht konnte. Aber die letzten Jahre scheitere ich
eigentlich immer weniger. Es gibt sicher schwächere Arbeiten, für die
ich einfach nicht mehr genügend Kraft hatte, aber ich empfinde das
nicht als Scheitern, ich berechne mit ein, dass es Fehlversuche gibt.
Sie vermitteln ein wenig den Eindruck eines Naturburschen. Andererseits
leben Sie in Wien, als Vorlage dienen Ihnen Fotos. Ist Ihnen die
vermittelte Erfahrung lieber als das Naturerlebnis?
Das Erleben ist schon die Hauptsache, das interessiert mich in erster
Linie. Ich arbeite auch stark aus der Erinnerung heraus, das Foto
brauch‘ ich eigentlich gar nicht. Es ist für mich eine Erleichterung,
aber es ist nicht mein Thema. Diese Unmittelbarkeit der Erfahrung, die
ich mit der Leinwand und der Farbe mache, ist das, was mich eigentlich
interessiert und wovor ich immer auch ein wenig Angst habe.
Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind mit der Leinwand?
Ja, ich gehe nicht sehr ernsthaft an die Sache ran, es herrscht
manchmal Betrieb, und ich merke schon, wenn Leute da sind, die bauen
sich irgendwie mit in die Arbeit ein.
Wie steht’s mit Kritik an Ihrem Werk?
Ich habe keine Ahnung, wie die Presse über mich schreibt, ich lese das
aus Angst sehr selten. Aber es gibt schon ein paar lustige Artikel, in
denen man mich als pathetischen Extremmaler bezeichnet oder mir
vorwirft, dass ich eine Blume male.
Wenn man mal „junger Wilder“ war, wovon löst man sich denn zuerst: Von der Wildheit? Von der Jugend?
Heruntergekommen und alt fühle ich mich (lacht). Aber ich war nie ein
junger Wilder, mir hat das nie gepasst, man hat mich nie gefragt, ob
ich mich damit identifiziere. Ich war noch zu jung.
Aber gerade alt genug für New Wave.
Das war unglaublich wesentlich für uns. Ich kann mich an eine Zeit
erinnern, da hatte ich mit Gerwald Rockenschaub (diesjähriger
documenta-Teilnehmer, Anm.) zusammen eine Wohnung. Es lebte noch ein
Musiker dort, und wir haben mit Sound experimentiert. Wir wollten, dass
das, was wir damals unter Malerei verstanden, mit dieser Mode zu tun
hat, vor allem mit der Musik. Mittlerweile bin ich aber nur mehr
Konsument. Ich habe zwar eine E-Gitarre dort stehen, auf der vertreibe
ich mir manchmal die Zeit. Oder ich lege mir beim Malen eine schräge CD
ein. Ich besitze da einen völlig wüsten Geschmack. In einem
Esoterikladen habe ich kürzlich eine CD einer indischen Sängerin
gekauft, die Krishna besingt, auf Schnulzenpop. Aber wenn ich Ihnen die
vorspiele, Sie würden sie mir über den Kopf hauen.
nur mit schriftlicher Genehmigung der Falter Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. gestattet.